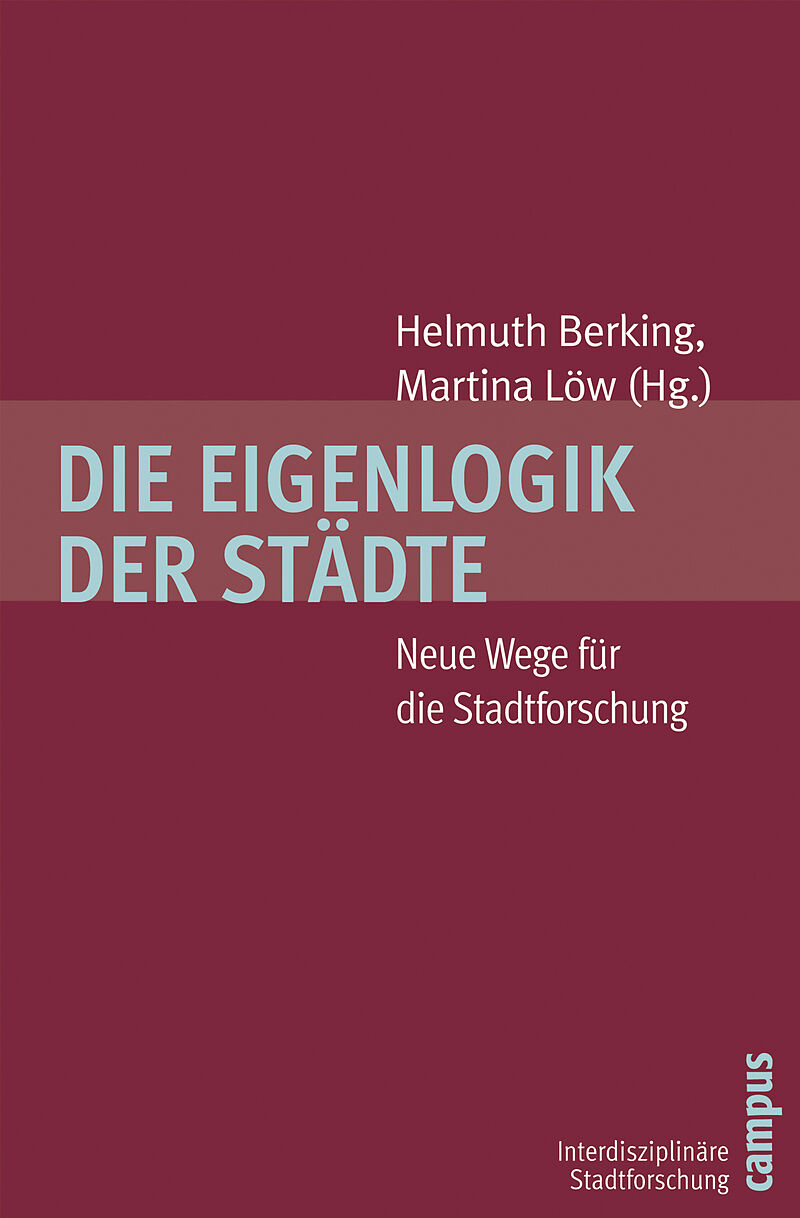Die Eigenlogik der Städte
Einband:
Paperback
EAN:
9783593387253
Untertitel:
Neue Wege für die Stadtforschung
Genre:
Stadt- & Regionalsoziologie
Herausgeber:
Campus Verlag GmbH
Auflage:
1. Aufl. 10.2008
Anzahl Seiten:
335
Erscheinungsdatum:
31.10.2008
ISBN:
978-3-593-38725-3
Neue Reihe: Interdisziplinäre Stadtforschung Herausgegeben vom Forschungsschwerpunkt "Stadtforschung" an der TU Darmstadt
Städte unterscheiden sich in ihrer Struktur und Anlage, in ihrem Potenzial, ihrer Geschichte und den Images, die sie hervorrufen. Obwohl die Differenzen im weltweiten Wettbewerb an Bedeutung gewinnen, wird die globale Angleichung der Städte zurzeit weitaus umfassender erforscht. Vor diesem Hintergrund verschiebt die neue Reihe die Perspektive von der Stadt auf diese Stadt. Städte werden in ihrer historisch gewachsenen und technisch-materiell fundierten Gestalt so analysiert und ins Verhältnis gesetzt, dass strukturelle Differenzen und Gemeinsamkeiten in den Blick geraten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der eigenen Logik, die der Entwicklung jeder Stadt zugrunde liegt, sowie auf dem »lokalen Wissen«, das zur Lösung von Problemen beitragen kann. Die Herausgabe der Reihe erfolgt im interdisziplinären Verbund von Stadtforschern und Stadtforscherinnen aus den Sozial- und Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Bauwesen und Architektur.
Autorentext
Helmuth Berking, Prof. Dr., ist Permanent Fellow der Fachgruppe Planungs- und Architektursoziologie an der Technischen Universität Berlin. Bis 2016 war er Professor für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt. Martina Löw ist Professorin für Planungs- und Architektursoziologie an der TU Berlin.
Leseprobe
Einleitung Helmuth Berking, Martina Löw Am 23./24. Juni 2007 fand in Darmstadt ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Rundgespräch zum Thema "Die eigensinnige Wirklichkeit der Städte. Positionen zur Neuorientierung in der Stadtforschung" statt. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Stadtsoziologie, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus den Fächern Politikwissenschaft, Europäische Ethnologie, Geografie, Geschichtswissenschaft, Sportwissenschaft, Philosophie und Ökonomie diskutierten gemeinsam über Möglichkeiten und Grenzen, über neue Perspektiven und alte Probleme in der Erforschung der "Stadt". Im Mittelpunkt des Disputes standen die Präsentation und die kritische Würdigung einer Forschungsperspektive, durch die "die Stadt" und die Städte als eigensinnige Gegenstände konzeptualisiert und empirisch erschlossen werden sollen. Dieser Band dokumentiert die (erweiterten) Beiträge jener Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops, die in unterschiedlichsten analytischen Zugriffen diese Idee einer lokalspezifischen, eigensinnigen Wirklichkeit von Städten zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen machen und in einer solchen Herangehensweise einen theoretisch und methodisch innovativen Weg für die Stadtsoziologie und die Stadtforschung sehen. Die konzeptionelle Idee lässt sich zunächst als kritischer Einwand gegenüber der vorherrschenden Tradition der Stadtforschung so formulieren: Nicht länger und ausschließlich in den Städten forschen, sondern die Städte selbst erforschen, "diese" im Unterschied zu "jener" Stadt zum Gegenstand der Analyse machen. Vor dem Hintergrund der typischen Theorieannahmen erweist sich dieser Perspektivwechsel als keinesfalls trivial. Denn auf der einen Seite findet sich ein bereits mit der Chicago School beginnendes Theorieprogramm, "Stadt" lediglich als Teilmenge beziehungsweise als Subkategorie von "Gesellschaft" zu fassen. Die Stadt tritt gleichsam als Laboratorium für Gesellschaftsprozesse jedweder Art in den Aufmerksamkeitshorizont der Sozialwissenschaften. Diese subsumtionslogische Theoriefigur (Berking/Löw 2005), die "die (Groß-)Stadt gemeinhin als Spiegel oder Bühne der Gesellschaft beziehungsweise als Laboratorium der (Post)Moderne" (Frank 2007: 548) konstruiert, erreichte in der "New Urban Sociology" ihre kohärenteste Form sowie ihren wirkungsmächtigsten Ausdruck. Auf der anderen Seite lässt sich eine gesteigerte Aufmerksamkeit für kleinräumige Vergesellschaftungsprozesse - im Stadtteil, im Quartier, im Milieu et cetera - konstatieren. Es geht um Lebensformen, um Lebensstile, um Migrations- und Armutsquartiere, kurz, um die spezifischen Orte spezifischer sozialer Gruppen in der Stadt. In beiden Fällen aber geht nicht nur das Spezifische der Vergesellschaftungsform Stadt, sondern auch die Besonderheit dieser Stadt als Gegenstand der Forschung verloren (vgl. Berking/Löw 2005; Löw 2008). Die durchgängige Substitution des Forschungsobjekts "Stadt" durch "Gesellschaft" lässt sich von der Annahme leiten, Strukturprobleme des Kapitalismus, Ungleichheitsrelationen und Ausbeutungsmuster könnten wie in einem Brennglas in der Stadt abgebildet werden. Es sind vor allem drei, vorrangig im Kontext der relativen wohlfahrtsstaatlichen Stabilität der deutschen Nachkriegsgesellschaft sowie mit Bezug auf die "kapitalistische Stadt" entwickelte Argumente, die dafür angeführt werden, dass lokale Kontextbedingungen, Wissensbestände und Wirkungsgefüge für die stadtsoziologische Theoriebildung eher von sekundärer Bedeutung sind beziehungsweise nur als Filter wirken (vgl. z.B. Häußermann/Siebel 1978; Häußermann/Kemper 2005; Saunders 1987; Krämer-Badoni 1991): Die Urbanisierung der Gesellschaft nivelliere die Stadt-Land-Unterschiede und verbiete somit, Stadt als eigenständigen sozialen Tatbestand zu benennen; der administrativ festgelegte Raum Stadt sei keine soziologische Kategorie; Städte seien zu unterschiedlich, als dass Stadt selbst Gegenstand von Forschung sein könne. Flankiert werden diese Argumente durch Vorschläge, die Analyse von Städten gegenüber anderen räumlichen Organisations- beziehungsweise Siedlungsformen nicht länger zu privilegieren (Hamm/Atteslander 1974; Friedrichs 1977; Mackensen 2000). Diese Grundsatzentscheidungen haben dazu geführt, dass die Erforschung der konkreten Stadt weitgehend zugunsten von Gesellschaftsanalysen in der Stadt preisgegeben wurde. Vor dem Hintergrund neuer Forschungsergebnisse zur Lokalisierungspolitik, zu Modernisierungskonzepten sowie zur Raumtheorie teilen alle Beiträge dieses Bandes die Erkenntnisabsicht, diese Grundsatzentscheidung zu überdenken und die forschungsstrategische Bedeutung einer eigenlogischen Entwicklung von Städten zum zentralen Thema machen. Wir stellen die Frage, inwieweit die notwendige Reformulierung der stadtwissenschaftlichen Perspektiven zugleich theoretisch-konzeptioneller und methodisch-empirischer Erweiterungen bedarf - oder ob sogar eine "Neuerfindung" (Läpple 2005) der Stadt und der Stadtforschung auf der Tagesordnung steht. Die analytische Aufmerksamkeit richtet sich auf die eigensinnige Strukturbildung moderner Städte, auf ihre im Unterschied zum modernen Territorialstaat distinkte, raumstrukturelle Form und den damit einhergehenden soziokulturellen Inklusionserwartungen (Held 2005). Was folgt aus der Annahme, dass sich die für die moderne Großstadt signifikanten Aggregatzustände - größere soziale und stoffliche Masse, Heterogenität und Dichte (Wirth 1974) - strukturell von den Homogenitätsanforderungen des überformenden Nationalstaates unterscheiden? Liegt nicht die unwahrscheinliche, sozialintegrative und kulturelle Leistung moderner Urbanität gerade in der "institutionalisierten Indifferenz für Differenzen" (Hondrich 2006: 493) von Lebensstilen, sozialen Praktiken, der Ko-Existenz und Ko-Evolution von symbolischen Universen, die dort zum Tragen kommt und kommen muss, wo die Nivellierung von Differenz auf der normativen Grundlage territorialstaatlicher Einschlussmechanismen zwangsläufig an Grenzen stößt? Bilden materielle, soziale und kulturelle Heterogenität und nicht Homogenität folglich das genuine Forschungsfeld der Stadtforschung? Die Stadtsoziologie in Deutschland kann zwar viel über die Stadt als Laboratorium der Gesellschaft sagen, aber bisher nur wenig über die Stadt als distinktes Wissensobjekt der Sozialwissenschaften. Die Grundsatzentscheidung, Städte in …

Leider konnten wir für diesen Artikel keine Preise ermitteln ...
billigbuch.ch sucht jetzt für Sie die besten Angebote ...
Die aktuellen Verkaufspreise von 6 Onlineshops werden in Realtime abgefragt.
Sie können das gewünschte Produkt anschliessend direkt beim Anbieter Ihrer Wahl bestellen.
Loading...
Die aktuellen Verkaufspreise von 6 Onlineshops werden in Realtime abgefragt.
Sie können das gewünschte Produkt anschliessend direkt beim Anbieter Ihrer Wahl bestellen.
| # | Onlineshop | Preis CHF | Versand CHF | Total CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seller | 0.00 | 0.00 | 0.00 |