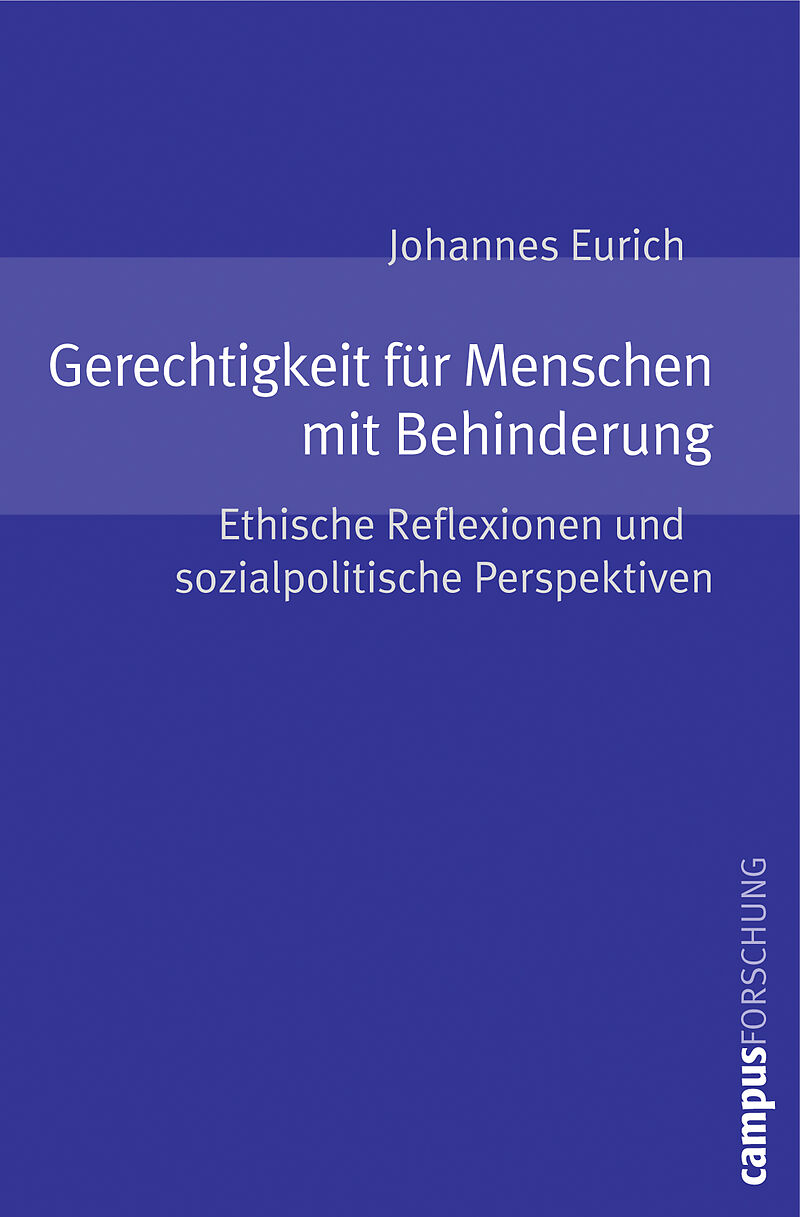Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung
Einband:
Paperback
EAN:
9783593385778
Genre:
Philosophie-Lexika
Autor:
Johannes Eurich
Herausgeber:
Campus Verlag GmbH
Erscheinungsdatum:
31.10.2008
Um Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung zu verwirklichen, reichen gleiche Rechte, Selbstbestimmung und die Forderung nach Teilhabe nicht aus. Wie aber können in den aktuellen Debatten zur Gerechtigkeit die spezifischen Bedürfnisse behinderter Menschen berücksichtigt werden? Am Beispiel von Rawls Gerechtigkeitstheorie diskutiert Johannes Eurich die anthropologischen und sozialen Voraussetzungen der liberalen Gerechtigkeitstradition und greift neuere Ansätze aus den Disability Studies auf. Der Wechsel von einer defizit- zu einer ressourcenorientierten Sicht von Menschen mit Behinderung führt zu einer vertieften anthropologischen Betrachtung, die in theologischer Perspektive ausgeführt wird. Auf dieser Grundlage können die sorgende Liebe für Menschen mit Behinderung und deren kulturelle Gleichwertigkeit als ergänzende Aspekte begründet werden. Beide tragen dazu bei, den Anderen in seiner Verletzlichkeit anzuerkennen und gleichzeitig die politische Realisierung von Gerechtigkeit voranzutreiben.
Vorwort
Interkulturelle Studien Hg. von Hans Nicklas
Autorentext
Johannes Eurich ist Professor für Ethik in der Sozialen Arbeit an der Ev. FH in Bochum.
Leseprobe
1 Der strukturelle Zusammenhang zwischen Kontraktualismus, Normalisierung und Behinderung "Gewalt fängt nicht da an, wo Menschen getötet werden, sondern dort, wo man sagt, du bist krank und du musst tun, was ich dir sage." Erich Fried 1.1 Der Vertragsgedanke als Grundlage individueller Rechte Ursprünglich wurde der Vertragsgedanke in der politischen Philosophie eingeführt, um einen universalen Konsens hinsichtlich der legitimen Einschränkung der Freiheit des Einzelnen zu erzielen. Durch den Vertragsgedanken wird nicht nur individuelle Freiheit wechselseitig zwischen zwei Parteien begründet, sondern auch die Basis für die Rechtsansprüche des Einzelnen gegen den Staat gelegt. Zugleich steht der Vertragsgedanke im Hintergrund vieler sozialpolitischer Regelungen. Die Grundidee des Vertragsgedankens besagt, dass individuelle Freiheit nur dann beschränkt werden darf, wenn dem Vertrag (Kontrakt) als wechselseitiger Übertragung von Rechten und Pflichten freiwillig zugestimmt wird und jede Vertragspartei dadurch einen Vorteil hat. Der Vertrag etabliert also Menschen als gleichberechtigte Personen mit wechselseitig eingeschränkter Freiheit. Bereits eine Generation nach Veröffentlichung dieser Grundidee durch den englischen Philosophen Thomas Hobbes wurden die autoritären Eingriffsmöglichkeiten des Staates zunehmend begrenzt. Das vertragliche Wechselseitigkeitsverhältnis wird auf die Beziehung zwischen Staat und einzelnem Bürger angewandt. Damit gewinnt die Idee des Vertrages ein kritisches, gegen die Dynamik der Asymmetrie von Staat und Bürger gerichtetes Potential. Mit zunehmender geschichtlicher Entwicklung wurde die faktische Ungleichheit zwischen Staat und einzelnem Bürger durch die Kodifizierung von Abwehr-, Mitwirkungs- und Anspruchsrechten zu korrigieren versucht. Im 20. Jahrhundert fanden dann diese Ideen Eingang in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Mittels liberaler Grundrechte, politischer Mitwirkungsrechte und sozialer Rechte kann der einzelne Bürger/Bürgerin Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe einfordern. Dies gilt in besonderem Maß für gesellschaftlich marginalisierte, unterdrückte oder diskriminierte Personen(gruppen), zu denen oftmals auch Menschen mit Behinderung zählen. In den Sozialgesetzbüchern hat der Gesetzgeber versucht, die Grundrechte des Menschen in sozialstaatlichen Regelungen so zu konkretisieren, dass Freiheit und Würde des Einzelnen abgesichert sind und menschenwürdige Verhältnisse hergestellt werden können. 1.2 Die moderne Erfahrung des Behindertseins Die skizzierte Entwicklung vom Vertragsgedanken zu den Persönlichkeitsrechten und ihrer Verankerung in der Verfassung hat zwar eine überaus wichtige, positive Bedeutung für die Entwicklung moderner demokratischer Staaten einschließlich all ihrer Vorzüge für den Rechtsstatus des einzelnen Bürgers, jedoch zeigen sich in der weiteren Explikation und Umsetzung der Grundrechte (zum Beispiel in den existenzsichernden Bestimmungen des Sozialgesetzbuches und der daraus folgenden institutionellen Praxis sozialstaatlicher Hilfe) ambivalente Phänomene. Im Blick auf die politische Gemeinschaft schützt das Grundgesetz die Würde des Menschen als unantastbar und formuliert damit einen Grundwert, der gerade für die von Schicksalsschlägen wie Unfall, Krankheit, Behinderung betroffenen Menschen auch den Schutz vor Diskriminierung sowie eine soziale Sicherung beinhaltet. Die verfassungsrechtlich festgeschriebene Gleichheit verbürgt, dass Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung und damit auch bestehende Ungerechtigkeiten als Unrecht erkennbar und einklagbar werden. Jedoch wirken die einzelnen rechtlichen Regelungen zur Ausgestaltung dieses Grundrechts auf zwiespältige Weise. So sind in der sozialstaatlichen Praxis neben den positiven Aspekten der Existenzabsicherung, Förderung und Unterstützung von Hilfebedürftigen auch die negativen Auswirkungen dieser Praxis zu benennen: Sozialstaatliche Regelungen bestimmen immer stärker den Alltag und bringen neue Sozialfiguren wie zum Beispiel den Frührentner, Sozialhilfe-Empfänger, Schwerbehinderten erst hervor. Diese Sozialfiguren üben eine identitätsbildende Macht aus. Es ist hier zu fragen, ob die durch sozialstaatliche Regelungen verliehene Etikettierung und die damit verbundene Aussonderung das moderne Phänomen der "Behinderung" nicht eigentlich erst konstituiert.
Inhalt
Inhalt Vorwort 1 Einleitung 1.1 Der Fokus auf Gerechtigkeit 1.2 Gerechtigkeit und der moderne Sozialstaat 1.3 Gerechtigkeit - begriffliche Vorklärungen 1.3.1 Vier Formen von Gerechtigkeit 1.3.2 Soziale Gerechtigkeit 1.4 Zum Aufbau der Arbeit 1.4.1 Sozialphilosophische Orientierung 1.4.2 Die Schattenseite der liberalen Gerechtigkeitstradition 1.4.3 Theologische Orientierung 1.4.4 Weiterführende Perspektiven für Forschung und Sozialpolitik 1.5 Der Begriff "Behinderung" Teil I Sozialphilosophische Orientierung 1 Gerechtigkeit als Fairness - die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls 1.1 Die Wahl von Gerechtigkeitsgrundsätzen 1.2 Die Herleitung von Verteilungsgerechtigkeit 1.3 Würdigung und Kritik der Gerechtigkeitstheorie von Rawls 1.3.1 Methodologische Kritik 1.3.2 Kommunitaristische Kritik 1.4 Zwischenfazit 2 Gerechtigkeit als Fairness auch für Menschen mit Behinderung? 2.1 Kritik der Rawlsschen Kooperationsgemeinschaft 2.2 Erweiterung der Rawlsschen Gerechtigkeitstheorie 2.2.1 Die Begründung von Gesundheitsinstitutionen nach Daniels 2.2.2 Der Fähigkeitenansatz von Sen 2.2.3 Der Zusammenhang zwischen Lebenschancen und der Funktionsfähigkeit einer Person 3 Soziale Bedingungen von Freiheit und Gleichheit 3.1 Gleichheit als soziales Verhältnis 3.2 Gleichheit in Verteilungs- und Anerkennungsperspektive 3.3 Selbstachtung und gleiche soziale Beziehungen 3.4 Gleichheit und Freiheit 3.5 Zwischenfazit 4 Die Gewährleistung sozialer Bedingungen von Freiheit 4.1 Vergleich von Daniels' und Andersons Gewährleistungsideen 4.2 Soziale Dienste als Grundgut? 4.3 Die Vereinbarkeit der Gewährleistung sozialer Bedingungen von Freiheit mit Rawls' Gerechtigkeitstheorie 4.4 Die Konkretisierung der Gewährleistung sozialer Bedingungen von Freiheit 4.4.1 Eingrenzung der zu sichernden Ressourcen 4.4.2 Gleichwertige Rechte 5 Gerechtigkeitsziele und Gerechtigkeitskriterien 5.1 Gleichheit und ihre Ziele 5.2 Kriterien der Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung 5.2.1 Moralisches Minimum 5.2.2 Teilhabe 5.2.3 Eigenverantwortlichkeit 5.2.4 Selbstbestimmung 5.2.5 Die Kriterien der Bedarfs- und Verfahrensgerechtigkeit 5.2.6 Die Kriterien der Kompensations-, Prozesschancen- und Zugangsgerechtigkeit 5.3 Zwischenfazit Teil II Die Schattenseite der liberalen Gerechtigkeitstradition in philosophischer und theologischer Perspektive 1 Der strukturelle Zusammenhang zwis…

Leider konnten wir für diesen Artikel keine Preise ermitteln ...
billigbuch.ch sucht jetzt für Sie die besten Angebote ...
Die aktuellen Verkaufspreise von 6 Onlineshops werden in Realtime abgefragt.
Sie können das gewünschte Produkt anschliessend direkt beim Anbieter Ihrer Wahl bestellen.
Loading...
Die aktuellen Verkaufspreise von 6 Onlineshops werden in Realtime abgefragt.
Sie können das gewünschte Produkt anschliessend direkt beim Anbieter Ihrer Wahl bestellen.
| # | Onlineshop | Preis CHF | Versand CHF | Total CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seller | 0.00 | 0.00 | 0.00 |